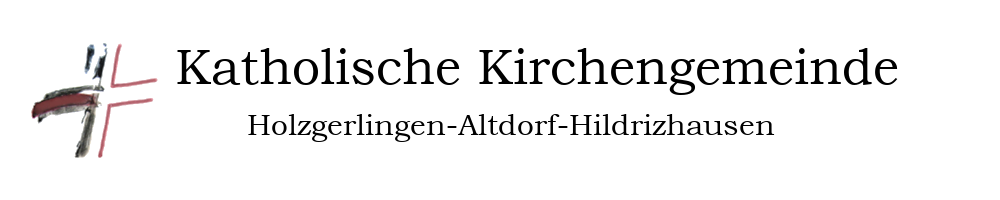Ansprache zum Caritasgottesdienst am 26. September 2021
Gehört die zu uns? Woher stammt der überhaupt? Hab ich die bei uns überhaupt schon mal gesehen?
Fragen, die man immer mal wieder zu hören bekommt. Fragen, die wir uns in bestimmten Situationen vielleicht auch selber schon gestellt haben. Wer gehört zu uns und wer nicht? Wer sind wir und wer sind die anderen?
Um Zugehörigkeitsfragen geht es auch im heutigen Evangelium. Um die Perspektive „wir“ und „die anderen“. Um „für“ und „wider“. Um „gegeneinander“ und „gemeinsam“.
Ein Mensch, dessen Name nicht überliefert ist, tut Gutes. Er treibt Dämonen aus. Heute würde man vielleicht sagen: Er befreit Personen aus dem Bannkreis von Kräften, die ihr Leben einengen und zerstören. Dabei tut er das nicht im eigenen Namen, sondern im Namen Jesu. Also nicht aus eigener Kraft, sondern bewusst im Vertrauen auf die Kraft Gottes. Er stellt sein Tun in die Perspektive der Botschaft Jesu: nämlich umzukehren und die Welt Schritt für Schritt zum Guten, zum Reich Gottes zu wandeln. So leistet dieser Mensch mit seinen Taten einen wertvollen Dienst. Er hilft mit, dass es weniger Leid gibt, dass Wunden heilen, dass jemand neuen Mut bekommt und eine neue Perspektive. Er hilft mit, dass Menschen wieder ihr Leben in die eigene Hand nehmen können, dass sie dem, was sie niedergedrückt hat, entkommen konnten und ihre eigenen Kräfte wieder spüren und nutzen können. „Empoverment“ nennt man das auf neuhochdeutsch in der heutigen Sprache der sozialen Arbeit.
Eigentlich würde man doch erwarten, dass die Jünger Jesu das gutheißen. Sie sind doch selbst diejenigen, die im Namen und im Sinne Jesu unterwegs sind, die seine Lebensaufgabe und seine Berufung teilen. Müssten nicht gerade sie demjenigen, der wie sie einen Beitrag zum Reich Gottes leistet, Respekt entgegenbringen? Müssten nicht gerade sie ihn loben, ihn ermutigen, ihm danken? Mit ihm in den Austausch gehen, sich ihrerseits von ihm Inspiration und Ermutigung holen? Sie arbeiten doch schließlich gemeinsam am gleichen Ziel. Diesem Menschen ist doch etwas geglückt, wofür auch sie sich nach Kräften einsetzen.
Aber etwas ganz anderes Geschieht. Nicht nur, dass die Jünger kein Wort des Respekts, der Anerkennung, des Lobes über die Lippen bringen, sie versuchen sogar, den anderen an seinem Tun zu hindern. Und warum das alles? „Weil er uns nicht nachfolgt. „ Weil er nicht zu uns gehört. Weil er nicht ein Teil unserer Organisation ist. Weil er nicht in unsere Systemlogik passt. Weil er nicht unseren Stallgeruch hat und weil er unserem Image nichts nützt, unsere Reputation dadurch nicht wächst und unsere Mitgliedszahlen dadurch nicht steigen.
Die Jünger befinden sich in einem Wahrnehmungsmodus, der den Blick verengt und ihre Gefühle in eine bestimmte Richtung zwingt. „Konkurrenzmodus“ könnte man das nennen. In diesem Konkurrenzmodus erlebe ich die Menschen, die doch eigentlich mit mir auf demselben Weg sind, nicht als Begleitung oder Bereicherung, sondern als Bedrohung. Ich habe Angst, dass sie mir „die Butter vom Brot stehlen“, dass sie mich in den Schatten stellen, dass mein Ansehen und meine Geltung leiden. Und so verliere ich das Ziel des gemeinsamen Weges aus den Augen. Ich verliere den Blick dafür, dass wir uns doch eigentlich wunderbar ergänzen und uns gegenseitig viel geben könnten auf dem gemeinsamen Weg.
Diese Verhaltensweise hat sich in der Geschichte der Kirche leider immer wieder wiederholt und das hat Auswirkungen bis in die Gegenwart.
Ein Beispiel aus der Geschichte: im 19. Jahrhundert ist als Folge der industriellen Revolution eine neue Gesellschaftsschicht entstanden: die Arbeiterschaft oder auch Proletariat genannt. Diese Menschen lebten in unvorstellbare Armut und Abhängigkeit. Kinderarbeit war der Normalfall, die Arbeiter hatten keine Rechte und keine Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder im Alter. Die widerkehrenden wirtschaftlichen Krisen verschärften ihre Not noch weiter. Es war ein Zeichen der Zeit, dass man diese unmenschlichen Zustände ändern muss. Parteien und Gewerkschaften entstanden, die sich des Problems annahmen und sich für die Rechte der Arbeiter einsetzten. Auch die Kirche sah die Not und es sind viele charismatische Persönlichkeiten – Geistliche, Ordensangehörige und auch sogenannte Laien, gewesen, die sich für diese Menschen eingesetzt haben. Adolf Kolping sei hier nur als ein Beispiel genannt. Aber das war alles eng auf die eigene Institution ausgerichtet. Die Amtskirche ging in dieser Frage nur sehr zögerlich und in Abgrenzung zu den anderen Kräften ihren eigenen Weg, statt sich mit ihnen zusammen zu tun, obwohl sie doch alle das gleiche (man kann sagen: jesuanische) Ziel hatten: Menschen in Armut und ohne Rechte in ihrer Not beizustehen. Außerdem war die Institution Kirche in dieser Zeit gerade mal wieder mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt und darauf bedacht, sich von den anderen abzugrenzen und ihren Weg in Konkurrenz zu den anderen gesellschaftlichen Kräften zu gehen. Es war die Zeit des ersten Vatikanischen Konzils, in der sich der Vatikan gegen den neu entstandenen italienischen Staat wehren musste und des Kulturkampfes zwischen Staat und katholischer Kirche in Deutschland. Versuche, die Angrenzung zu den anderen gesellschaftlichen Kräften zu überwinden, wie es z.B. die Arbeiterpriester in Frankreich taten, wurden von Rom unterbunden.
Und so kam es zu dem, was der Jesuit und bekannteste Verfechter der Katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Breuning einmal als den größten Skandal der Kirchengeschichte nannte, nämlich dass die Kirche die Arbeiterschaft verlor. Die wandte sich denen zu, die ihre Anliegen und Interessen kraftvoller und überzeugender vertraten als die Kirche. Zwar hat die Kirche später versucht, sozusagen noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen, hat christliche Gewerkschaften gegründet, den 1.Mai als Tag des Hl. Josef, des Arbeiters, eigeführt (1955!) u.s.w. Aber das blieb nur noch Schönheitskosmetik und daran hat sich bis heute nichts geändert. Kirche, Gewerkschaften und Arbeiterschaft sind bis heute ein schwieriges Kapitel.
Wie es auch ganz anders gehen kann, haben wir in der sogenannten Flüchtlingskrise gesehen. Da haben nicht nur Tausende von Menschen, sondern auch zahlreiche Institutionen, angefangen von Staat bis zu den beiden Kirchen an einem Strang gezogen und mit ihrer Willkommenskultur gezeigt, dass ihnen das Schicksal von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, nicht egal ist. Auch wenn sie dafür von Teilen unserer Gesellschaft als naive Gutmenschen verächtlich gemacht oder auf üble Art diffamiert wurden. Für mich ist in dieser Zeit wenigstens kurz aufgeleuchtet, was möglich wäre, wenn wir uns als Gesellschaft auf unserer gemeinsamen Werte besinnen und gemeinsam etwas anpacken und uns nicht von Angst, Konkurrenzdenken und Egoismus leiten lassen.
Das machen wir gemeinsam. Der Titel der diesjährigen Jahreskampagne des Caritasverbandes ist eine Ermutigung, sich frei zu machen von Eifersucht, Angst und Konkurrenzdenken. Stattdessen sollen wir das solidarische Potential entdecken und fördern, das in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Im Großen wie im Kleinen. Wer etwas dazu beiträgt, dass das Leiden weniger wird, wer sich einsetzt für Menschen in Not, wer etwas Gutes tut, der ist mit uns auf dem Weg. Das ist es, was zählt. Wo es uns gelingt, uns frei zu machen von Konkurrenzkampf und Eifersucht, da entdecken wir neue Ressourcen, neue Formen der Solidarität, neue gemeinsame Perspektiven.
Es gibt vieles, was gemeinsam besser gelingt. Es gibt so viel solidarisches Potential. In den Kirchengemeinden, wenn man mit offenem Blick und offenem Herzen schaut. Und in Sozialraum, wenn Initiativen, Vereine, Kommunen, Institutionen und Privatpersonen an einem Strang ziehen.
Das Evangelium des heutigen Sonntags ermutigt uns, unseren Blick zu weiten. Nicht zuerst von unserem Image und unserer Institution zu denken, sondern vom gelingendem Leben, von einer lebenswerteren Welt, vom Reich Gottes her. Und mit offenem Herzen alle willkommen zu heißen, die dafür einen Beitrag leisten. Amen.